- Jugendliche
- Fachpersonen (Schule, Jugendarbeit...)
- Eltern
-
QR-Code für diese Seite
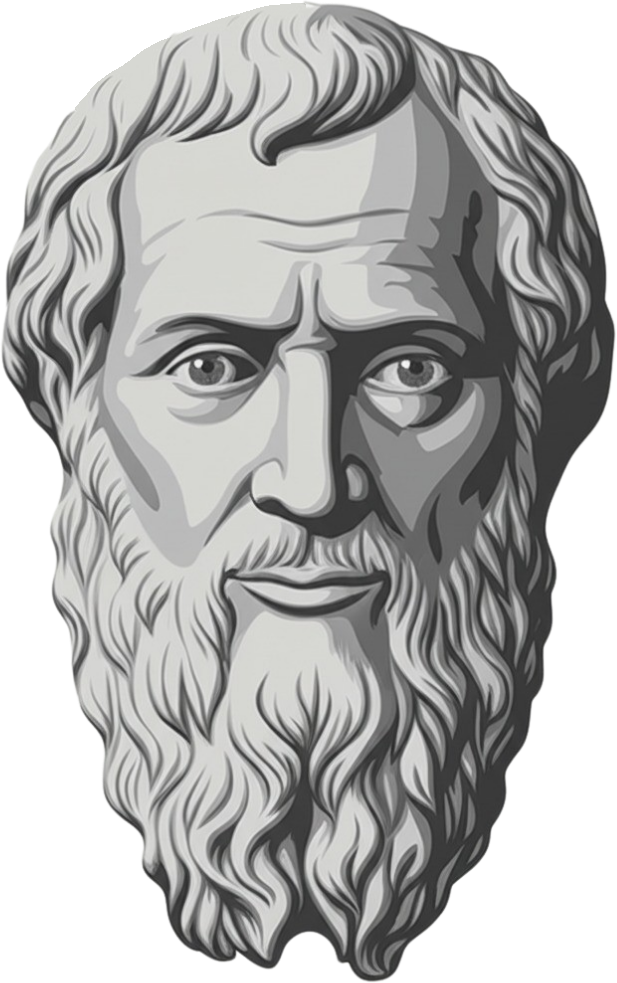
Mobbing bedeutet, dass jemand wiederholt und über längere Zeit von anderen schlecht behandelt wird – etwa durch Beleidigungen, Ausgrenzung oder Drohungen. Ziel ist es, die betroffene Person kleinzuhalten, zu demütigen oder fertigzumachen.
Mobbing ist keine Bagatelle, sondern eine ernstzunehmende Belastung, die tiefe und langanhaltende Spuren hinterlassen kann. Betroffene entwickeln oft ein geringes Selbstwertgefühl, fühlen sich ängstlich oder traurig und ziehen sich möglicherweise sozial zurück. Manche kämpfen mit sinkenden Leistungen, verlieren die Freude an Schule oder Arbeit oder brechen diese sogar ab. Auch körperliche Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen, Nervosität, Müdigkeit und Schlafstörungen können auftreten. Langfristig kann es diesen Menschen schwerfallen, anderen zu vertrauen oder sich in sozialen Situationen wohlzufühlen.
Wer zur Zielscheibe von Mobbing wird, kann sich selten allein wehren. Deshalb ist es wichtig, dass Sie versuchen, die Entstehung von Mobbing möglichst zu verhindern – und konsequent eingreifen, wenn Sie Mobbing beobachten. Wegzuschauen kann schwerwiegende Folgen für die Betroffenen haben.
Wenn Sie an einer Schule tätig sind, empfehlen wir, dass die Schule als Ganzes klare Verhaltensregeln gegen Mobbing aufstellt – getragen von der gesamten Schulgemeinschaft. Eine einheitliche, kohärente Haltung und Strategie wirken nachhaltiger als punktuelle Einzelaktionen.
Präventiv wirken alle Aktivitäten, die positive Erlebnisse in der Klasse ermöglichen sowie die sozial-emotionalen Kompetenzen und eine offene, respektvolle Gesprächskultur fördern. Bewährt haben sich beispielsweise ein regelmässiger Klassenrat, in dem die Jugendlichen offen über Probleme sprechen können, gemeinsame Projekte oder Aktivitäten, bei denen soziales Verhalten geübt wird. Diese Massnahmen und Aktivitäten stärken das Miteinander. In einem solchen Umfeld ist Mobbing seltener – weil gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung zur Norm wird.
Um Mobbing zu verhindern, braucht es die Unterstützung der Klasse. Erklären Sie den Jugendlichen zunächst, welche gravierenden Folgen Mobbing haben kann – oder lassen Sie sie selbst dazu recherchieren. Anschliessend empfehlen wir, gemeinsam mit der Klasse verbindliche Verhaltensregeln zu formulieren. Z.B.:
Dabei sollte auch thematisiert werden, welche Massnahmen bei Regelverstössen sinnvoll sind. Zum Beispiel:
Es ist ebenso sinnvoll, die Eltern darüber zu informieren, was die Schule zur Prävention von Mobbing unternimmt und warum das wichtig ist. Dabei ist die Schule darauf angewiesen, dass auch die Eltern zu Hause die klare Haltung vertreten, dass Beleidigungen, Ausgrenzungen oder Bedrohungen anderer nicht toleriert werden. Im Rahmen von Informationsabenden können Empfehlungen gegeben werden, wie mit Unterstützung der Eltern das Risiko von Mobbing in der Schule reduziert werden kann. Zum Beispiel:
«Allgemein gilt: Mobbing hört nicht von allein auf. Mobbing betrifft alle, alle sind beteiligt. Nur mithilfe erwachsener Personen kann Mobbing auf Dauer erfolgreich unterbunden werden» (Quelle).
Wenn Mobbing trotz vorbeugender Massnahmen auftritt, ist rasches Handeln entscheidend.
Führen Sie Gespräche mit Täter*innen und Betroffenen und setzen Sie die gemeinsam erarbeiteten Regeln konsequent um. Reichen diese nicht aus, sollten Schulsozialarbeit oder Schulleitung frühzeitig eingebunden werden, um eine Eskalation zu verhindern.
Wer von Mobbing betroffen ist, braucht Rückhalt. Zeigen Sie dem Kind, dass es ernst genommen und geschützt wird - zum Beispiel durch vertrauliche Einzelgespräche oder eine Sitzordnung neben verlässlichen Mitschüler*innen.
Wichtig ist eine vertrauensvolle Beziehung: Zeigen Sie dies, indem Sie zum Beispiel auf die Einhaltung von Regeln achten sowie gemeinsam mit der gemobbten Person, dem Täter oder der Täterin und den Eltern nach Lösungen suchen.
Führen Sie zuerst ein Gespräch mit der gemobbten Person und anschliessend mit deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, in dem informiert und Orientierung gegeben wird. Für mögliche Massnahmen wird das Einverständnis der gemobbten Person eingeholt. Es ist wichtig, nicht über ihren Kopf hinweg zu entscheiden, sondern einen vertrauensvollen Umgang zu pflegen.
Anschliessend findet ein Gespräch mit den Mobbenden statt. Dabei wird die Haltung der Schule klar kommuniziert: Mobbing wird nicht geduldet. Die Mobbenden werden konkret mit ihrem Verhalten konfrontiert, auf Schuldzuweisungen oder Sanktionen wird jedoch verzichtet (siehe «No Blame Approach»).
In der Schweiz und in anderen Ländern hat sich der sogenannte «No Blame Approach» als gute Methode zur Beendigung von Mobbing bewährt. Dabei stellt die Lehrperson eine kleine Gruppe von Schüler*innen zusammen - darunter auch Kinder, die vorher nicht beteiligt waren oder einsichtige Täter*innen. Gemeinsam überlegt die Gruppe, wie dem gemobbten Kind geholfen werden kann. Dabei geht es nicht darum, jemanden zu bestrafen oder blosszustellen, sondern Lösungen zu finden. Viele der gemobbten Kinder fühlen sich durch die Hilfe entlastet. Die Methode ist im Schulalltag leicht umsetzbar und hilft, das Klassenklima zu verbessern.
Wir haben Jugendliche gefragt, warum es aus ihrer Sicht Mobbing gibt und was man dagegen tun kann. Ergänzend zu den bisherigen Massnahmen können Sie betroffene Jugendliche auf diese Seite verweisen:
In Kapitel 8 von Schoolmatters finden Sie weitere lesenswerte Informationen zum Thema Mobbing in der Schule:
Kinder von Eltern mit einer psychischen Erkrankung sind mit grossen Herausforderungen konfrontiert und haben ein deutlich höheres Risiko, psychische Gesundheitsprobleme zu entwickeln. Doch Prävention ist möglich. Durch die Unterstützung von Eltern und Familien kann ihre Widerstandsfähigkeit gestärkt werden.
Im Auftrag des BAG hat die ZHAW verschiedene Informationsmaterialien zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen entwickelt.
Es gibt vier TAKE CARE - Publikationen für unterschiedliche Zielgruppen:
Kinder von Eltern mit einer psychischen Erkrankung sind mit grossen Herausforderungen konfrontiert und haben ein deutlich höheres Risiko, psychische Gesundheitsprobleme zu entwickeln. Doch Prävention ist möglich. Durch die Unterstützung von Eltern und Familien kann ihre Widerstandsfähigkeit gestärkt werden.
Im Auftrag des BAG hat die ZHAW verschiedene Informationsmaterialien zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen entwickelt.
Es gibt vier TAKE CARE - Publikationen für unterschiedliche Zielgruppen:
feel-ok.ch ist ein Angebot der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, das Informationen für Jugendliche und didaktische Instrumente u.a. für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachpersonen der Jugendarbeit zu Gesundheitsthemen enthält.
20 Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz, das BAG und Stiftungen unterstützen feel-ok.ch.
Cookies werden für die Nutzungsstatistik benötigt. Sie helfen uns, das Angebot deinen Bedürfnissen anzupassen und feel-ok.ch zu finanzieren. Dazu werden einige Cookies von Drittanbietern für das Abspielen von Videos gesetzt.
Mit "Alle Cookies akzeptieren" stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit am Ende der Seite ändern oder widerrufen.
Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder deine Einstellungen ändern möchtest, klicke auf "Cookies wählen".
Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.